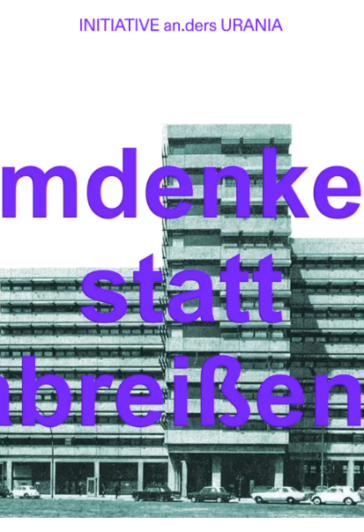Quelle: Felix Hartenstein
Quelle: Felix HartensteinWie viele andere Menschen gehe auch ich seit Ausbruch der Pandemie regelmäßig spazieren. Mitte Dezember, am ersten Tag des zweiten „harten“ Lockdowns, bin ich einmal die Turmstraße auf und ab geschlendert, eine belebte Einkaufsstraße in Berlin-Moabit. Was hat sich verändert, seit die neuen Einschränkungen in Kraft sind? Leider ziemlich wenig.
Gleich mein erster Gedanke, als ich auf die Straße trete: „Ist ja genau wie gestern“. Auf dem Bürgersteig herrscht geschäftiges Treiben, die Schaufenster erleuchten das trübe Wintergrau, der Verkehr rauscht wie eh und je. Kein Vergleich zum ersten Lockdown im Frühling, als wochenlang eine Ruhe über der ganzen Stadt lag, wie sie sonst nur in den Morgenstunden vor dem Berlin-Marathon zu erleben ist, ehe sich die ersten Zuschauer an die Strecke begeben. Heute aber ist von Ruhe keine Spur: ein Mittwoch, so scheint es, wie jeder andere.
Der zweite Lockdown war notwendig geworden, nachdem der Versuch, die Infektionen durch einen „Lockdown light“ zu verringern, zuvor nicht funktioniert hatte. Die angestrebten Kontaktbeschränkungen wurden nicht erreicht, die Fallzahlen überstiegen die des Frühjahres um ein Vielfaches. Folgerichtig also die Verschärfung von „light“ zu „hart“. Das Ergebnis am ersten Tag: überschaubar.
Kaum Einschränkungen für den Einzelhandel
Fast alle Geschäfte sind geöffnet. Supermärkte, Drogerien und Apotheken sowieso, aber auch Optiker, Handy-Läden, Spätis und Buchhändler haben aufgesperrt und warten auf Kundschaft. Der Druckerladen hat Glück, so wie einige andere auch; dank seines angeschlossenen Paket-Shops darf er den Betrieb aufrechterhalten. So kurz vor Weihnachten sollen die ersehnten, online bestellten Geschenke nicht bis zum Ende der Einschränkungen in einer Paketannahmestelle auf Halde liegen.
Von den Passanten trägt, grob überschlagen, nur jeder zweite eine Maske, obwohl das entlang der Turmstraße wie in vielen belebten Bereichen eigentlich vorgeschrieben ist. Zugegeben, die Hinweisschilder hängen ziemlich hoch, sind relativ klein und leicht zu übersehen.
 Quelle: Felix Hartenstein
Quelle: Felix HartensteinDie Rückkehr der Rücksichtslosogkeit
Ich denke zurück an das Frühjahr, als für einige Tage ungeahnte Rücksichtnahme und Freundlichkeit in das oftmals passiv-aggressive Hauptstadtleben eingekehrt waren. Auf dem Gehsteig umkreisten die Leute einander wie tänzelnde Bienen, lächelten sich verschüchtert zu, sorgsam darauf bedacht, den Mindestabstand einzuhalten. Bisweilen spielten sich unbegreifliche Szenen ab: Vor den Ladentüren ließen Kunden einander den Vortritt, sagten gar „bitte“, „danke“ und „Entschuldigung“.
Aus, vorbei! Längst herrschen wieder die ungeschriebenen Gesetze des Trottoirs. Wer einem Entgegenkommenden ausweicht, fällt in der Kiez-Hierarchie schnell eine Stufe ab. Es wird hemmungslos gedrängelt, gemurrt und auf das Pflaster gerotzt. – War was?
Schwierige Abwägung: Was ist in Corona-Zeiten verzichtbar?
Neben dem Einzelhandel ist es vor allem die Gastronomie, die an der Turmstraße für Lebendigkeit sorgt. Das Angebot umfasst den typischen Berliner Mix: Döner, Pizza, Currywurst, dazu Sushi, Burger und Backwaren. Hunger leiden muss hier niemand, alle Imbisse und Restaurants laufen wie gewohnt, wenn auch ohne Sitzbereiche.
Geschlossen sind lediglich die Ein-Euro-Läden, Friseure und Beauty Shops, Spielotheken und einige Fachgeschäfte – darunter ein Lampenladen, ein Reisebüro und ein paar Juweliere. Selbst der Ökomarkt vor der Heilandskirche findet statt. Ich schlendere eine Runde über den Platz und wundere mich. Geräucherte Forelle, Lakritz und hausgemachte Maultaschen. Ist das alles wirklich unverzichtbar?
Für die Händler geht es um die Existenz, das ist klar. Doch mich beschleicht das Gefühl, dass wir mit den momentanen Maßnahmen das Schlechteste aus beiden Welten bekommen: ernstliche wirtschaftliche Einbußen für bestimmte Handelsbranchen, Gastronomen, Kulturschaffende und Gewerbetreibende (mit Ausnahme von Supermärkten, Drogerien und Baumärkten, die neben dem Onlinehandel zu den Pandemiegewinnern zählen), gepaart mit weiterhin viel zu hohen Infektionsraten.
 Quelle: Felix Hartenstein
Quelle: Felix HartensteinLieber kurz und heftig als halbherzig und dauerhaft?
Wäre es nicht zielführender und auf lange Sicht weniger schmerzhaft, für ein paar Wochen das öffentliche Leben auf ein Mindestmaß herunterzufahren und konsequent alles dicht zu machen, was nicht absolut essentiell ist, bis die Fallzahlen auf ein vertretbares Maß gesunken sind, um danach rasch zu einem einigermaßen gewohnten Leben zurückkehren zu können, anstatt die halbherzigen Maßnahmen und damit den gesellschaftlichen Ausnahmezustand auf unabsehbare Zeit aufrechtzuerhalten?
Andere Länder haben längst vorgemacht, dass es geht. Das chinesische Wuhan, wahrscheinlicher Ausgangspunkt der Pandemie, ist dank eines sehr harten, aber erfolgreichen Lockdowns praktisch coronafrei und befindet sich auf dem Weg zu einer neuen Normalität. Auch in Japan, Südkorea und Singapur sind die Fallzahlen geringer als in Deutschland, ebenso in Australien und Neuseeland. Die Gemeinsamkeit: konsequentes Handeln und kurze aber effektive Einschnitte (eine Insellage kann wahrscheinlich auch nicht schaden).
 Quelle: Felix Hartenstein
Quelle: Felix HartensteinWeiterwurschteln ist keine Option
Von meinem Spaziergang bleibt der Eindruck, dass die aktuellen Maßnahmen allenfalls geringfügig dazu beitragen, das öffentliche Leben in der erforderlichen Weise zu reduzieren. Man kann es den Leuten nicht verübeln, bei all den Ausnahmen und Widersprüchen. Was also tun?
Die angelaufene Impfkampagne wird nach heutigem Stand zu lange dauern, als dass man die Situation einfach weiterlaufen lassen könnte. Gesundheitsexperten rechnen damit, dass wir erst im Sommer eine ausreichende Impfquote erreichen werden, um die gesamte Bevölkerung zu schützen. Bis dahin müssen andere Lösungen her.
Weiter so rumzuwurschteln, um dann irgendwann doch gezwungen zu sein, härtere Anordnungen zu erlassen, wäre die schlechteste Alternative, und würde zusätzliche psychische, soziale und wirtschaftliche Schäden verursachen. Wäre es da nicht die bessere Entscheidung, trotz des Unbehagens, das einen beim Gedanken an weitere Einschränkungen überkommt, möglichst zeitnah einen harten Lockdown auszurufen, der seinen Namen wirklich verdient, um die Situation nicht unnötig in die Länge zu ziehen? *
Nachdenklich trotte ich nach Hause. Mit der Turmstraße verbindet mich eine tief empfundene Hass-Liebe. Sie ist laut und ruppig, gleichzeitig pulsiert hier das urbane Leben in seiner ganzen Pracht. Ich mag diese Gegensätze. Und weil mir die Straße mit ihren Menschen so am Herzen liegt, wünschte ich, dass sie für eine Weile in den Winterschlaf ginge, um im Frühling wieder unbeschwert erblühen zu können.
* Update (6. Januar): Noch während ich diesen Text zur Veröffentlichung vorbereite, kommt die Nachricht, dass der bestehende Lockdown bis zum 31. Januar verlängert und um zusätzliche Kontaktbeschränkungen erweitert wird.